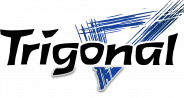Zur Premiere der Theateraufführung (28. August 2021) der Jungen Bühne am Goetheanum.
Schon in der Eingangsszene leuchtet der Kern der Odysseus-Biografie auf. Liebe. Daneben marschierende Soldaten. Sie versetzen ins 20. Jahrhundert. Einer bricht aus. Er will nicht mit. Als er sich dem Krieg doch nicht entziehen kann, verspricht er: «Ich komme zurück. Das schwör ich bei Zeus.» Diese Zuversicht kann nur haben, wer Sinn im Leben gefunden hat. In der Liebe. In der Beziehung zu Penelope mit ihrem neugeborenen Sohn Telemachos. Diese Liebe stirbt nicht, auch nicht in zwanzig Jahren, die voll äußerem Ungemach, Unglück und notwendigen Umwegen sind. Sie verblasst nicht und geht nicht verloren, weil es den Liebenden gelingt, sie immer wieder neu zu greifen, zu erleben. Beispielsweise Odysseus am Ende der Kirke- und der Kalypso-Szene. Sobald es dann an der Zeit ist, leuchtet sie blendend wie die Sonne von Neuem auf.
Das Wagnis, einen so großen, schweren Stoff zu bewältigen, ist gelungen. Im ersten Teil (vor der Pause) wirkt das Theaterspiel breit erzählend, mutet episch an. Die ‹Ilias› – in Kürzestform aufs Wesentlichste beschränkt – ist integriert. Entscheidend die Abschiedsszene zu Beginn des Stücks, wo Odysseus von Penelope weggehen muss.
Die Rückkehr bleibt ein Wunder
Die Telemachie wird im vorliegenden Stück lebendig. Der jugendliche Telemachos sucht seinen Vater Odysseus. Athene hilft. An der Premiere ist mir aufgegangen: Diese Geschichte gehört zur ‹Odyssee›. Auch wenn mein Griechischlehrer und die meisten Altphilologen uns einreden wollen, sie sei erst später dazugedichtet worden. Das spielt für mich keine Rolle. Ihr zentrales Motiv ist Hoffnung. Aus ihr erwächst die Kraft, den Freiern um Penelope standzuhalten, ihnen die Stirn zu bieten. Diese Freier sind so dreist, dass einem bang wird, ob sie nicht doch noch gewinnen.
Im ersten Teil ist Odysseus’ Gang in die Unterwelt zentral. «Er bedeutete die Überwindung des Vergänglichen und die Auferweckung des Ewigen in der Seele.» (Rudolf Steiner ‹Das Christentum als mystische Tatsache›) Sehr schwer, dies auf der Bühne darzustellen, gar für die Zuschauer und Zuschauerinnen erlebbar zu machen. In vorliegender Inszenierung gelingt diese Quadratur des Zirkels. Zum ‹Wie› vergleiche man den Artikel von Wolfgang Held über die Probenarbeit im letzten ‹Goetheanum›. Der Dialog zwischen Antikleia und ihrem Sohn Odysseus in der Unterwelt, in welchem er erkennt, dass sie aus Gram um ihn gestorben ist, geht unter die Haut. Seine hervorbrechende Trauer ist die Geburtsstunde oder die Bewusstwerdung seines innersten Wesens in der Überwindung des Todes. Seine ‹Einweihung›.
Der zweite Teil lebt im Dialogisch-Dramatischen. Ohne den so passend geschriebenen Text des Antihelden, des Anführers der Freier, Antinoos und seine ausgezeichnete spielerische Umsetzung könnte der Darsteller des Odysseus nie jene Kraft und jenes Können entwickeln, welche seine Rückkehr glaubwürdig erscheinen lassen. Der Kampf gegen die Freier, den ich seit meiner Schulzeit vom Gefühl her als grausam, sogar als unnötig brutal empfunden hatte, wird hier zur Notwehr, zum moralisch berechtigten Befreiungsschlag. Bis zum Schluss fiebert man mit, ob Odysseus seine Heimkehr gelingt; denn sie hängt davon ab, ob er mit den Freiern fertigwird. Diese herrschen in der Zwischenzeit faktisch über Ithaka, haben die Herrschaft des rechtmäßigen Fürsten Odysseus usurpiert. Wie macht man die Folgen eines Staatsstreichs, einer Diktatur rückgängig? Unmöglich. Andrea Pfaehlers Dramatisierung der ‹Odyssee› lässt uns an eine solche Möglichkeit glauben. Auch im alltäglichen Leben gibt es sie. Mir selbst kommt der Fall der Berliner Mauer in den Sinn. Ähnlich wie die Rückkehr des Odysseus ein Wunder.
Die Inszenierung der Jungen Bühne trifft einen Nerv des heutigen Zeitgeistes. Es ist kein Zufall, dass am Basler Stadttheater der von der Presse dafür hoch gelobte Regisseur Antú Romero Nunes, Mitglied der Theaterdirektion, dort kürzlich auch die ‹Odyssee› inszeniert hat. Auf der kleinen Bühne. Und jetzt laufen immer noch seine ‹Metamorphosen› nach Ovid im Schauspielhaus. Heute scheint es leider schwer geworden zu sein, die ‹Sprache› der klassischen Mythen oder wie er sie nennt ‹Geschichten› zu verstehen. Er schreibt im Programmheft der ‹Metamorphosen›: «Wir brauchen Geschichten, um uns in der Welt zu orientieren. […] Durch das Erzählen von Geschichten wird eine Welt konstruiert.» Beim Inszenieren gelte es, diese Geschichten zu dekonstruieren. Das Resultat dieses Prozesses sei «eine neue Realität». «Aber auch diese neue Realität offenbart sich wieder als Konstruktion.» Und so immer weiter. Nunes’ künstlerischer Ansatz ist ein konstruktivistischer. Denken wird als Konstruieren verstanden. Wahrheit, wenn es sie denn überhaupt geben sollte, bleibt unzugänglich, unerreichbar. Ganz anders hat seinerzeit Rudolf Steiner die Mythen ‹gelesen›. (Zu seiner Deutung der ‹Odyssee› vergleiche den Text unten aus seinem 1902 erschienenen Buch ‹Das Christentum als mystische Tatsache und die Mysterien des Altertums›.)
Mythen sind mehr als Konstrukte
Jeder Mythos kann zwar verkommen, als ‹konstruierte› Ideologie sogar politisch missbraucht werden. Mythen haben aber einen tieferen Sinn. Auf diesen kommt es an. Der Ansatz Steiners für jede künstlerische Umsetzung eines Mythos besteht darin, diesen tieferen Sinn sichtbar, erlebbar zu machen. Der Inszenierungsansatz von Andrea Pfaehler und ihrem Team, mit dem dies gelingt, ist deshalb im besten Sinne des Wortes in Schauspielkunst umgesetzte Anthroposophie. Eine solche Bühnenkunst braucht es heute mehr denn je. Sonst gehen uns Mythen, Märchen und ähnliche ‹Geschichten› allmählich verloren oder verkommen zum Comic-Strip.
Eine letzte Bemerkung sei noch erlaubt: Der Hinweis auf die ausgezeichnete Sprache (Jutta Nöthiger und Torsten Blanke), auf Tanz (Leonie Gebhardt und Siljan Sussmann) und Musik (einige Jugendliche selbst). Die Leistung der Jugendlichen berührt tief innen. Traurig stimmt, dass die Aufführung der ‹Odyssee›, die neunte große Produktion der Jungen Bühne in Folge, die letzte sein soll. So zu lesen in Andrea Pfaehlers Brief ans Publikum in der Programmzeitung.
Wolfgang Klingler
Erschienen in: Das Goetheanum – Wochenschrift für Anthroposophie Nr. 36, 3. September 2021
Rudolf Steiner zur ‹Odyssee›
«Innerhalb der griechischen Weltanschauung bedeutete der Gang in die Unterwelt die Überwindung des Vergänglichen und die Auferweckung des Ewigen in der Seele. Dass Odysseus solches vollbracht hat, muss also zugegeben werden. Und damit gewinnen seine Erlebnisse ebenso wie diejenigen des Herakles eine tiefere Bedeutung. Sie werden zu einer Schilderung eines Nicht-sinnlichen, des Entwicklungsganges der Seele. Daszu kommt, dass in der ‹Odyssee› nicht so erzählt wird, wie das ein äußerer Tatsachenverlauf verlangt. Auf Wunderschiffen legt der Held Fahrten zurück. Mit den tatsächlichen geografischen Entfernungen wird in der willkürlichsten Weise umgesprungen. Es kann eben gar nicht auf das Sinnlich-Wirkliche ankommen. Das wird verständlich, wenn die sinnlich-wirklichen Vorgänge nur erzählt werden, um eine Geistesentwicklung zu illustrieren. […]
Einen Mann, der die Seele, das Göttliche sucht, hat man vor sich; und die Irrfahrten nach diesem Göttlichen werden erzählt.»
Aus: Rudolf Steiner, ‹Das Christentum als mystische Tatsache und die Mysterien des Altertums›