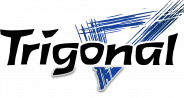Wenn Menschen aus tiefstem Herzen solidarisch miteinander sind, verliert Geld seine Bedeutung. Zwei fast utopische Orte, wie sie unterschiedlicher kaum sein können, zeigen das.
K20, Salzderhelden
Was für ein sagenhafter Name: Salzderhelden. Doch so wenig der Ortsname tatsächlich aus dem Märchen stammt — er leitet sich ganz profan von den Salzstöcken ab, die der Region im Mittelalter Wohlstand gebracht haben —, so wenig zauberhaft ist die ökonomische Situation hier im nie – dersächsischen Harzvorland. Das Dorf, etwa 20 Zugminuten von Göttingen entfernt, leidet unter den typischen Problemen kleiner Gemeinden in strukturschwachen Gebieten. Die Jungen ziehen weg, Einzelhandel und Handwerk verschwinden, Leerstände und verfallende Fassaden mehren sich.
Seit einem Jahr aber verändert sich in Salzderhelden etwas, und das begann an einem Frühjahrstag 2020 auf einem Deich am Leinepolder. Dort stand Eva Brunnemann, um ihrem Freund und Weggefährten Tobi Rosswog ein zum Verkauf stehendes, baufälliges Fachwerkhaus zu zeigen. Wäre das nicht genau der richtige Platz für ein Kollektiv zum Aufbau solidarischer Strukturen? Wo Geben und Nehmen voneinander entkoppelt sind und alle Menschen will – kommen sind, egal, was sie beitragen können? Brunnemann, Sozialpädagogin und in der Lokalpolitik für die Linken aktiv, trennt von Rosswog, 31, eine Generation. Aber sie verbindet die Überzeugung, dass die Gesellschaft eine Transformation braucht, weg von bürgerlichen Kategorien wie Arbeit, Eigentum und Kapital hin zu einer Solidarökonomie, die frei ist von hierarchischem Denken und persönlicher Vorteilsnahme. Die Idee eines utopischen Ortes, von K20, war geboren.
Mithilfe der Stiftung Freiräume, die bundesweit freie Arbeits-, Wohn- und Lebensprojekte operativ und finanziell unterstützt, wurde das denkmalgeschützte Haus in der Knickstraße 20 gekauft, dessen Adresse dem Projekt den Namen gab. Über Netzwerke und soziale Medien wurde der utopische Freiraum bekannt gemacht und Leute für die dringenden Renovierungs- und Umbauarbeiten gesucht. „Es war überwältigend zu sehen, wie viele Menschen das Projekt gemeinsam gestalten wollten und sich mit ihren Talenten einbrachten“, erzählt Rosswog. 2013 hat er sein Studium abgebrochen und sein ganzes Geld verschenkt, um mehrere Jahre geldfrei zu leben. Dieses „Lebensexperiment“, wie er es bezeichnet, thematisierte er unter anderem in seinem Buch „After Work“, das für einige mediale Aufmerksamkeit sorgte. Seitdem öffnet und präsentiert er seinen Erfahrungsschatz bei Workshops und Vorträgen in ganz Deutschland.
Utopie mit wenigen Mitteln
Mittlerweile wohnen und arbeiten im K20 ein Dutzend Menschen zwischen 20 und 30 Jahren. Sie leben wie in einer Symbiose, eigenen Besitz gibt es in der Regel nicht, es wird fast alles geteilt. „Ich sage lieber: Diese Schuhe, diese Lampe oder dieses Fahrrad habe ich mitgebracht, aber es gehört der K20“, erzählt Valentin Krenkler, der als gelernter Tischler beim Ausbau des Hauses viel anschiebt. Für ihn war die Distanzierung von persönlichem Eigentum anfangs nicht immer einfach. „Ich dachte, ich stelle hier alles ganz cool zur Verfügung, was mir gehört, und musste dann doch feststellen, dass mir etwa mein Fahrrad sehr wichtig war.“ Gut sei es für ihn gewesen, diese Gefühle nicht zu leugnen. „Ich habe mich dabei erwischt, Sachen, die nach alter Auffassung mir gehörten, anders zu behandeln als die Dinge, die ich nicht mitgebracht habe.“ Für ihn sei das ein wichtiger Lernprozess: „Wir können nicht alles immer gleich so schaffen, wie es unsere Utopie verlangt, aber wir können darauf hinarbeiten.“
Ziel des K20 ist es, einen Ort zu schaffen, an dem Menschen geldfrei politisch aktiv sein können. Dabei ist allen klar, dass die Rahmenbedingungen dafür nicht geschaffen sind. „Am Ende kommen diese Projekte nicht ohne Geld aus, sie befinden sich ja immer noch auf Halbinseln, die auf eine Verbindung in das alte System angewiesen sind“, sagt Rosswog. Steuern und Abgaben müssten genauso bezahlt werden wie die laufenden Kosten für Wasser und Energie. Jeder, der das K20 nutzt, gibt deshalb, so viel er kann, in die gemeinsame Kasse.
Aber wo kommt dieses Geld her? Lotte Herzberg engagiert sich seit einem Jahr im K20 und zahlt im Monat einen solidarischen Beitrag, der sich danach richtet, was sie zahlen kann. Sie hat ein Studium in nachhaltiger Architektur abgeschlossen, arbeitete eine Zeit lang in einem Architekturbüro und hat etwas Geld gespart. „Wir haben hier ja alle kaum Lebenshaltungskosten, deshalb reichen die Einnahmen für eine lange Zeit.“ Einnahmen generieren einige der K20-Menschen mit ihrer Arbeit für das Medienkollektiv Wandelwerkstatt, das Grafikaufträge für Logos oder Buchprojekte aus dem politischen Aktivismuskreis erhält. Rosswog erzielt Einnahmen mit seinen Vorträgen, die er ins Kollektiv steckt. „In diesem Sinne kann ich mir persönlich auch vorstellen, irgendwann wieder meine Ausbildung zu nutzen, um etwa Bauanträge zu schreiben, und dafür eine Aufwandsentschädigung zu bekommen, wenn sie wirklich sinnvollen Projekten zugutekommen“, erzählt Herzberg und ergänzt: „Wir haben hier alles, was wir fürs Leben brauchen, um Geld sorgt sich hier dank der gelebten Solidarität keiner, glaube ich.“
Wenn viele Menschen zusammen leben, dann trägt jeder eine Verantwortung. An der großen Infotafel im Gemeinschaftsraum ist ablesbar, wie das funktioniert. Wer übernimmt heute die Küchenarbeit, wer kommt mit zum Supermarkt, um Lebensmittel zu retten, wer beteiligt sich am Bau eines Fahrradanhängers? Niemand ist gezwungen, eine Aufgabe zu übernehmen, und dennoch kommt es selten dazu, dass mal etwas liegen bleibt. „Geschirr einräumen etwa, da gibt es schon Verbesserungspotenzial“, sag Herzberg und lacht. „Die Grundidee ist, dass es ein offenes Haus ist, es übt also niemand das Hausrecht aus.“ Tauschmittelfreiheit ist das Gebot. „Bislang war es zum Glück so, dass die Menschen im K20 vor allem durch die Begeisterung der hier Lebenden angezogen wurden und für jeden klar ist, dass das Projekt nur funktioniert, wenn die Verantwortung nicht auf wenigen Schultern lastet“, sagt sie.
Kiste statt Kasse
„Tobi und ich haben Erfahrungswerte, wann solche Projekte auch an Grenzen stoßen“, sagt Brunnemann. Ein wichtiger Punkt seien klar definierte Rückzugsorte. Deshalb haben sie über kollektiv organisierte Kredite weitere leerstehende Häuser im Dorf gekauft, die fast ausschließlich zum Wohnen genutzt werden. Brunnemann selbst hat dort ein Zimmer und ihre Privatsphäre. „Wir organisieren unseren Alltag kollektiv, bleiben aber individuell in der konkreten Ausgestaltung.“
Junge Menschen, die in alternative Wohngemeinschaften in ein 2.000-Seelen-Dorf ziehen und Gebäude aufkaufen — gab es da keine Vorbehalte bei den Alteingesessenen? „Nein, im Gegenteil, wir fühlen uns total willkommen“, sagt Rosswog. Das kann man am Bahnhof erleben, der durch die Menschen vom K20 ein neuer Begegnungsort für das Dorf wurde. Die Gemeinde stellte den leerstehenden Kiosk pachtfrei zur Verfügung, mit der Auflage, im Bahnhof für Sauberkeit zu sorgen und kulturelle Angebote zu etablieren. Inzwischen finden dort regelmäßige Sonntagskonzerte statt, in der Woche werden im solidarischen Mitmachkiosk „Die Molli“ frühmorgens vegane Frühstücksbrote und Müslis angeboten und statt einer Preistafel steht auf der Theke eine kleine Kiste, in die jeder das legt, was er zahlen kann. Das war anfangs für die Pendler*innen und Schulkinder ziemlich ungewohnt, heute ist das hier: Normalität.
Ledigenheim, Hamburg Nachbarschaft in Gefahr
Auch in Hamburg begann eine Utopie mit der Entdeckung eines Gebäudes: Vor mehr als zehn Jahren suchte Antje Block im Anschluss an ihr Studium als Industriedesignerin zusammen mit ihrem Kollegen Jade Jacobs, der Visuelle Kommunikation studiert hatte, einen Platz zum Arbeiten und Gestalten. Nicht weit von der Michaeliskirche entfernt sah sie in einem Fenster einen Zettel, der auf freie Räume hinwies. Dass das Haus in der Rehhoffstraße, in dessen Erdgeschoss sie daraufhin einzogen, eine besondere Geschichte hatte, wussten beide zu diesem Zeitpunkt nicht. Das sogenannte Ledigenheim — eines der letzten in Deutschland — war 1912 im Zuge des sozialreformerischen Wohnungsbaus entstanden. Alleinstehenden Männern sollten ein Leben ohne Not und ein behütetes Zuhause in familienähnlichen Strukturen geboten werden. In einer Hafenstadt wie Hamburg bestand die Wohnklientel vorrangig aus Seeleuten und Hafenarbeitern. Als Block und Jacobs Ende der Nullerjahre in diese Nachbarschaft kamen, war sie deutlich heterogener; in den Zimmern wohnten nun Männer unterschiedlicher Berufsgruppen, Bildungshorizonte und Herkünfte. Was sie damals einte, war die Angst, ihre Bleibe zu verlieren: Ein dänischer Investor hatte den Wohnkomplex gekauft und wollte das Wohnprojekt auflösen.
„Die Bewohner waren aufgebracht“, erzählt Block beim Gespräch im ehemaligen Speisesaal des denkmalgeschützten Hauses, wo sie und Jacobs ursprünglich ihre Büroräume eingerichtet hatten. „Wir haben uns damals gefragt: Sollen wir unserer beruflichen Vorstellung weiter nachjagen oder unseren Nachbarn in einer existenziellen Lage zur Seite stehen?“, ergänzt Jacobs. Dass diese Entscheidung ihre Leben veränderte und sie am Ende für eine Immobilie verantwortlich wurden, war nie geplant.
Nachbarn als Glücksfall
Eine wichtige Rolle bei der Rettung des Ledigenheims spielte Michael Gerdes. Der gelernte Maschinenschlosser lebt seit 16 Jahren im Ledigenheim und ist in dieser Zeit zu einer Art Sprecher für die Bewohner geworden. „Als ich die Kündigung in meinem Briefkasten fand, wusste ich: Jetzt müssen wir kämpfen.“ Er informierte damals die Hamburger Medien, sorgte dafür, dass sogar der NDR berichtete, und wandte sich — ein Glücksfall — an die beiden Nachbarn aus dem Erdgeschoss. Ob die nicht vielleicht auch helfen konnten?
Sie konnten und wollten. „Uns wurde schnell klar, dass dieses Haus nur eine Zukunft hat, wenn man einen Eigentümer findet, dem glaubwürdig daran gelegen ist, das historische Ledigenheim in seiner Funktion zu erhalten“, erzählt Block. Zu diesem Zeitpunkt sah das alles andere als realistisch aus. Insbesondere im Zuge des Verkaufs an den Investor hatte sich die Sozialstruktur im Ledigenheim problematisch verändert, viele der Zimmer wurden damals an Menschen mit schwierigen sozialen Hintergründen vergeben. Gleichzeitig waren die sozialen Dienstleistungen auf – gelöst, Instandhaltungsmaßnahmen wurden vernachlässigt, das Haus verwahrloste. Nicht nur für die Bewohner im Ledigenheim, sondern auch für die direkte Nachbarschaft im Viertel war das sehr belastend. „Es gab hier regelmäßig ganz schön Ärger“, erinnert sich Gerdes und ergänzt, dass es mit Block und Jacobs endlich wieder verbindliche Ansprechpartner für die Bewohner gibt. „Die beiden kümmern sich um alle Belange und haben sich bei uns viel Respekt erworben, weil sie Konflikten nicht aus dem Weg gehen.“ Eine gewisse Konfliktfähigkeit sei schon eine Vor – aussetzung in einem Haus, in dem mehr als 100 erwachsene Männer zusammenleben, erzählt Jacobs. „Wir grenzen niemanden aus, jeder gehört zur Gemeinschaft, muss aber auch bereit sein, die Regeln der Gemeinschaft zu achten.“ Weder Jacobs noch Block sind in einem sozialen Beruf aus – gebildet, waren aber bereits lange ehrenamtlich in sozialen Jugendprojekten engagiert und strahlen eine Ruhe und Souveränität aus, die es braucht, um Autorität zu erlangen.
Niemand wollte ins Risiko gehen
Mit der Stiftung Ros, die beide 2013 mit der Hilfe von FreundInnen und ihren Familien gründeten, war der Anfang gemacht. Auch das Werben um Mittel und Spenden verlief zunächst sehr erfolgreich, 200.000 Euro hatten sie zusammen; die Unterstützung in den Medien und der Stadt selbst, der an der Erhaltung des historischen Ledigenheims gelegen war, half dabei sehr. Dies war auch notwendig und die Zeit drängte. Denn die ursprüngliche Idee, jemanden zu finden, der bereit war, ins Risiko zu gehen und das Ledigenheim in die Zukunft zu führen, war gescheitert. „Wir wurden auf der Suche nach Investoren und möglichen Trägern vor allem aus den Reihen der Lokalpolitik immer wieder gefragt: Könnt ihr das nicht selbst übernehmen?“, erzählt Jacobs. Aus den anfänglichen ein bis drei Tagen wöchentlich, die beide zunächst in das Projekt investierten, wurden schnell fünf. „Es gab immer wieder Momente, die schwierig waren“, erinnert sich Jacobs. Etwa, wenn wieder ein aussichtsreicher Investor abgesprungen war. Beide fühlten sich aber verpflichtet gegenüber den hier lebenden Männern: „Die Abmachung lautete: Ihr kämpft und zieht nicht aus, und wir unterstützen euch dabei, bleiben zu können“, sagt Block. Es sei nicht nur ihr persönlicher Einsatz gewesen; ohne die Initiative der Bewohner, ohne die vielen Spenden, ohne die Hamburger Politik und Verwaltung und letztlich die GLS Bank, die den Kauf des Hauses für die Stiftung absicherte, wäre diese Geschichte so nicht geschrieben worden. Weder Block noch Jacobs beziehen für ihre Arbeit ein Gehalt. „Wir haben nur geringe Lebenshaltungskosten und brauchen beide nicht viel, um gut zu leben“, erklärt Jacobs.
Türen sind immer offen
Die Geschichte des Ledigenheims hat eine gute Wendung genommen und sie ist noch lange nicht auserzählt. Bald sollen Sanierungs- und Umbauarbeiten beginnen. Das im Zweiten Weltkrieg zerstörte Dachgeschoss wird denkmalgerecht rekonstruiert, Modernisierungsmaßnahmen wie der Einbau eines Fahrstuhls und altersgerechter Sanitär- und Sozialräume sollen den Lebensstandard der Bewohner heben. Aber es ist auch ein Haus für die Nachbarschaft und darüber hinaus. „Unsere Türen sind immer offen“, sagt Block — und das gilt wortwörtlich. Es muss schon sehr stürmen und regnen, dass Türen und Fenster des Saals im Erdgeschoss einmal geschlossen sind. Kulturelle Veranstaltungen wie Lesungen und Konzerte, die durch die Pandemie nur eingeschränkt möglich waren, sollen zeitnah wieder häufiger stattfinden. Jeder ist hier herzlich eingeladen; weder für den Kaffee noch für eine Lesung wird ein Beitrag erwartet.
Und immer willkommen sind Menschen, die helfen möchten, das Ledigenheim als ein Haus des sozialen Zusammenhalts und des Miteinanders zu erhalten, ob mit Spenden, Ideen oder dem Bereitstellen eigener Talente. Ein Haus, das auch Menschen in schwierigen Lebenslagen eine Perspektive bietet — in einer Großstadt wie Hamburg sind solche Projekte fast utopische Orte.
Jan Abele
Erschienen in: Bankspiegel Heft 243, Ausgabe 2/2021
Die Verwendung des Artikels erfolgt nach Creative Commons 4.0 (creativecommons.org)
K20
Zum K20 in Salzderhelden gehören mittlerweile zwei weitere Häuser: ein Projekthaus mit Co-Working-Spaces, Solicafé und einem Bandproberaum sowie das Blaue Haus, das vor allem Wohnraum bietet. Wer in den Häusern in Salzderhelden leben möchte, Projekte mitgestalten und politisch aktiv sein will, gibt, was er kann. Aktivist und Mitinitiator Tobi Rosswog und die GLS Bank verbindet eine jahrelange Zusammenarbeit: „Die Bank hat Vertrauen in unsere Aktivitäten und unterstützt sie von Herzen. Alleine schon mit der Zusage, unsere Vorhaben bei Bedarf auch mit zu finanzieren. Das lässt frei aufspielen und schafft Möglichkeitsfenster, die stärken.“
Ledigenheim Hamburg
Das Ledigenheim in Hamburg bietet heute mehr als 100 Männern einen Wohnraum mit sozialer Einbindung. Susanne Kratt, zuständige Firmenkundenbetreuerin der GLS Bank, findet besonders spannend an dem Projekt, dass hier weder eine Projektgesellschaft noch eine klassische gemeinnützige Organisation mit einem Finanzierungswunsch an sie herantrat, „sondern eine eigentlich private Initiative, die jedoch einen rein sozialen Ansatz verfolgt und dabei eine große Herausforderung annahm.“ Dass das Projekt gelinge, hänge auch damit zusammen, dass die beiden Verantwortlichen darauf verzichtet haben, Stellen einzurichten, um sich ihre Arbeit entsprechend vergüten zu lassen. „Das Konzept, das Ledigenheim zu erhalten und gleichzeitig einen offenen Begegnungsort zu schaffen, ist für die Gesellschaft ein Gewinn.“
Stiftung Ros
Die gemeinnützige Stiftung Ros wurde 2013 von Antje Block und Jade Jacobs ins Leben gerufen. Der Name spielt auf ein bekanntes deutsches Weihnachtslied an, das beide bei einem Konzert in der dem Ledigenheim benachbarten Michaeliskirche (dem Hamburger „Michel“) hörten — der Name war geboren. Vorrangig soll mit der Stiftung das Ledigenheim in Hamburg erhalten werden. Übergeordnetes Ziel ist laut Selbstbeschreibung, ein Instrument zu schaffen, um mit den jeweils aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen besser umgehen zu können und im Sinne des Schönen, Wahren und Guten an der Gestaltung der Welt mitzuwirken. Info Und immer willkommen sind Menschen, die helfen möchten, das Ledigenheim als ein Haus des sozialen Zusammenhalts und des Miteinanders zu erhalten, ob mit Spenden, Ideen oder dem Bereitstellen eigener Talente. Ein Haus, das auch Menschen in schwierigen Lebenslagen eine Perspektive bietet — in einer Großstadt wie Hamburg sind solche Projekte fast utopische Orte.