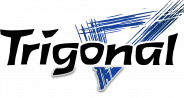Sofia Gubaidulina, eine Komponistinpersönlichkeit von Weltrang, beging am 24. Oktober ihren 90. Geburtstag. Zwei Themen haben sie in den letzten 20 Jahren besonders bewegt: die kulturelle Dekadenz und der moralische Verfall in der Gesellschaft sowie die Gewalt von religiösem und ethnischem Hass bis zum Mord. Sie hat dazu komponiert und geschrieben.

Foto: © Sikorski
Blickt man auf das Leben Gubaidulinas, so ist dieses bis 1991 parallel zu den großen Perioden des Sowjetsystems verlaufen: Als Tochter eines Tataren und einer Russin verbrachte sie die Stalin-Ära in Kasan und lernte im Studium hauptsächlich deutsche und russische Musik kennen; unter Chruschtschow studierte sie in Moskau und suchte ihren eigenen Weg; in der Breschnjew-Zeit gehörte sie zur kleinen Gruppe nicht angepasster Komponisten und Komponistinnen und führte ein schweres Dasein. Erst unter Gorbatschow durfte sie reisen. Und während des chaotischen und gewalttätigen Zusammenbruchs der Sowjetunion, was einen Bürgerkrieg nicht ausschloss, ist sie mit 60 Jahren nach Deutschland emigriert. Wenige Jahre später, 1998 und 2002, führten sie zwei Reisen zum Goetheanum, wo ihre Orchester-, Chor- und Kammermusikwerke beim zahlreichen Publikum einen tiefgehenden Nachklang hatten.
Nun lebt sie seit 30 Jahren in einem Dorf im Norden von Hamburg und kann ohne diese Abgeschiedenheit nicht komponieren, sich nicht in den immer wieder mühevollen Entstehungsprozess ihrer Werke vertiefen. Verliert sie in ihrem selbst gewählten Alleinsein nicht den Kontakt zur Welt? Zweifellos nein, denn einmal führen sie ihre Konzertreisen seit 35 Jahren um die Welt – Europa, Nordamerika, Australien sowie in die ostasiatischen Kulturen Japan, China, Korea. Insbesondere der vertikalen Kultur Japans und seiner Steingärten, in denen sich der Kosmos im Kleinen spiegelt, fühlt sie sich wahlverwandt und hat dort Werke für die Koto-Virtuosin Kazue Sawai komponiert.
Gleichzeitig ist sie innerlich Weltbürgerin geworden: Seit ihrer Kindheit war sie von Elementen der tatarischen Folklore umgeben, «die ich ‹subkutan› aufgenommen habe. Später in Moskau beschäftigte ich mich intensiv mit Musikkulturen verschiedener Völker weltweit – der armenischen, georgischen und jakutischen Folklore, der Musik der Pygmäen sowie jener aus Bali oder verschiedenen Gegenden Indiens. Und wenn ich auch vieles in meinem Werk nicht verwendet habe, sollte es einen Boden bereiten, auf dem mein eigenes Ich erwachsen könnte. Und dann möglichst genau und tief in das eigene Ich eindringen und herausfinden: Wer bin ich wirklich? Und jene Wahrheit, die ich dort in der Tiefe meines Wesens ausfindig gemacht habe, in Musik, in Klänge umsetzen.» Das ist ihr immer wieder gelungen.
Ihre geistig-seelische Selbstbeobachtung zeigt eine markante Parallele zu Worten Rudolf Steiners über diese Kunst, die ihr aber nicht bekannt waren. Dort heißt es: Die Musik enthält «die Gesetze unseres Ich, aber nicht so, wie wir sie im gewohnten prosaischen Leben ausleben, sondern hinuntergedrückt ins Unterbewusste, in den Astralleib hinein, gleichsam das Ich unter die Oberfläche des Astralleibes untergetaucht und darinnen, in der Gesetzmäßigkeit des Astralleibes, schwimmend und wogend.» (1)
Die Verwandlung der Zeit

© F. Hoffmann-La Roche Ltd.
Das selbstverständliche Zentrum von Gubaidulinas Schaffen ist die Religion – und wie oft in der russischen Kultur sind bei ihr Leben und Kunst eine untrennbare Einheit. So gestaltet sich ihr Komponieren immer wieder aus drei verborgenen Eckpunkten: der Stille, dem Feuer und dem Kreuz. In der Stille entsteht das Werk, wenn sie sich von der Welt des lärmenden Alltags frei gemacht hat und in die «Dunkelheit ihrer inneren Seelenlandschaft» eintaucht, die sie als reich und schöpferisch, aber gleichzeitig als tief und abgründig erlebt. In dieser Welt berührt sie ihr Lebenszentrum, die Suche nach dem Geistigen in der Kunst, die sie in ihren Werken zu gewaltigen Höhenflügen ausholen lässt. Von ihrem tatarischen Feuer sprechen nicht nur die apokalyptische Dramatik und die donnernden Fortissimo-Passagen mancher Werke, sondern auch das stille Glühen feinster lyrischer Stimmungen. Dieses Feuer ist die gewaltige Spannung ihrer Ausdruckskraft, welche sich durch ihre Kompositionen zieht. Das Kreuz schließlich ist Ausdruck ihres musikalischen Credos, der ‹Verwandlung der Zeit›, und spricht im Bild von der Durchdringung dieser beiden Elemente. In der Stille ihres ‹Seeleninnenraumes› entsteht in vertikaler Gleichzeitigkeit eine vielschichtige Werkidee – in der ‹vertikalen›, der ewigen Zeit. Diese wird in einem mühsamen Kreuzungsprozess in die ‹horizontale Zeit› verwandelt, das heißt strukturiert und zur aufführbaren Partitur ausgearbeitet. In der Aufführung schließlich, wenn die Chiffren der Partitur zu neuem Leben erweckt werden, ist die ‹vertikale Zeit› wiederhergestellt.
Vergnügungstanz auf dem Vulkan
Der Titel von Gubaidulinas Orchesterwerk ‹Das Gastmahl während der Pest› (‹Feast during a plague›) ist in Russland heute sprichwörtlich und bezieht sich auf Puschkins gleichnamige dramatische Skizze, die er 1830 in dreimonatiger Quarantäne wegen einer Choleraepidemie auf dem Landgut Borodina geschrieben hat – die Atmosphäre erinnert an die gegenwärtige Coronapandemie.
Während der Londoner Pest 1665 tafelt eine kleine, bunte Gesellschaft an der Straße und feiert mit melancholischen und lustigen Gesängen die Pest, als ein mit Leichen beladener Wagen vorbeigezogen wird. Ein Pfarrer, der versucht, der Gesellschaft ins Gewissen zu reden, wird weggeschickt. Nur der ‹Vorsitzende› der Gruppe versinkt daraufhin in tiefe Nachdenklichkeit, weil verschiedene der feiernden Gruppe nahestehende Menschen an der Pest verstorben sind.
Am 15. Februar 2006 dirigierte Simon Rattle in Philadelphia die Uraufführung dieses musikalisch und inhaltlich außergewöhnlichen Werkes mit dem Philadelphia Orchestra. Die Komposition beginnt emphatisch mit einer großen Fanfare der sechs Hörner, die im Folgenden in ihren Grundzügen immer wieder auftritt – in ihren großen Sprüngen, ihrer Kraft und dem wohlüberlegten Tempo. Die tiefen Streicher setzen ein, und bald spielt das ganze Orchester fortissimo. Eine nächste Welle beginnt mit Solo-Oboe und Flöte im Kanon und führt zu lärmigen Pizzicatos von Posaunen, Klavier und Kontrabässen, bis sich die Musik mit Trompeten auf einen massiven Höhepunkt zubewegt und das Ganze von der Fanfare in einem superhohen Register ausgeglichen wird. Da ertönt zu Beginn des letzten Werkdrittels eine neue Klangquelle, ein kurzer elektronischer Discorhythmus per Zuspielband, der das Publikum überrascht und noch mehrfach eingeblendet wird. Zum letzten Mal erklingt die Fanfare in Trompete, Flöte und Streichern, und das Werk verklingt mit solistischem Streichquartett, hohen Hörnern und Schlagzeug.
Nach dem letzten Ton rauschender Beifall, Johlen und einige Pfiffe, was sich noch steigerte, als Simon Rattle die Komponistin aus dem Auditorium auf die Bühne führte. Sie schien dankbar, aber auch etwas erstaunt über die starke Reaktion des Publikums, das sicherlich nach konkreten Entsprechungen der Musik zu Puschkins Szene gesucht hatte, wenn diese überhaupt bekannt war. So hörte man in der Pause folgende Bemerkung eines Konzertbesuchers: «What does that mean: Feast during Prague?» Selbst einige Kritiker und Kritikerinnen fühlten sich leicht desorientiert von dem, was sie gerade gehört hatten.
Denn Gubaidulina hatte deutlich angemerkt, dass es ihr nicht um eine direkte Darstellung der im Werktitel anklingenden Gefühle gehe, das berühre nur die äußerste Schicht der Komposition. Sie hatte in musikalischen Metaphern aus dem Bereich von Differenztönen komponiert und geht im unten folgenden Werktext auf den existenziellen Hintergrund des Titels ein – den gegenwärtigen Vergnügungstanz auf dem Vulkan.
Merklich kühler wurde das Werk von der Kritik in dem Gubaidulina gewidmeten ‹Barbican Weekend› 2007 aufgenommen. So nannte Richard Whitehouse in seiner ausführlichen Besprechung ‹Feast during a Plague› die größte Enttäuschung des Wochenendes und einen verschwendeten Kompositionsauftrag. (2) Es scheint, dass Gubaidulinas existenzielle Zivilisationskritik nicht zu seinem Repertoire gehört und dass die musikalischen Metaphern in ihrer seelischen Intensität seiner Kühle und Nüchternheit eher fremd geblieben sind.
In Amsterdam während der Gubaidulina-Festtage 2011 schien der Zusammenhang von Titel und Musik kaum Fragen aufzuwerfen. Denn «wenn man das Stück hört», so die Kritikerin Renée Reitsma, «ist kein Hintergrundwissen nötig – es spricht für sich selbst. Bei den Streichern gibt es einige schöne Schostakowitsch-ähnliche Melodien, die regelmäßig wiederholt werden, während Blechbläser und Schlagzeug viel aggressiver sind. Eines der auffälligsten Elemente dieser Musik waren der Schlagzeug- und der Bass-Beat aus den Lautsprechern. Abgesehen von einigen verwirrenden Passagen fließt die Musik und hält den Hörer bis zum Ende gefesselt. Ein solches Werk hatte ich noch nie zuvor gehört – wie oft bei Gubaidulina – und ich hoffe, es nochmals zu hören.» (3)
Gubaidulina zu ‹Das Gastmahl während der Pest›:
«Viele Leute in unserer Zeit bemerken und empfinden die Kalamität, die sich in der Menschheit ausbreitet – das Sinken des moralischen Niveaus in der Gesellschaft und das Entstehen von Hass in unseren Seelen. Der Kontrast zwischen diesem Bild einer Krankheit und der Tatsache, dass ein großer Teil der Menschen heute nichts anderes als feiern und ausgelassen sein will, schafft eine typische Situation, die oft in künstlerischen Werken beschrieben worden ist. Dabei entsteht eine geistige Verfassung, der man unmöglich entkommen kann. Was das Stück ausmacht, so besteht dieses weniger darin, eine solche geistige Verfassung auszudrücken, als im Schaffen einer rein musikalischen Metapher, die damit vergleichbar ist.
So ist es insbesondere die Metapher (einer rein akustischen Eigenschaft), welche die entscheidende Rolle in dieser Komposition spielt: In der Episode, welche das Klanggewebe des Orchesters zu einer Explosion bringt, werden die Blechbläser-Klänge zusammengepresst mit einem gleichzeitigen Beschleunigen des Tempos. Die Spannung dieser Akzeleration und die Spannung des Zusammenpressens kommen zusammen und verletzen das Prinzip des Ausgleichs. Und das ist der Grund für die nachfolgende Explosion.
In einer oberflächlichen Schicht wird diese gefährliche Situation markiert von Schlägen in das Klanggewebe des Orchesters durch fremde, aggressive, simple rhythmische Einwürfe, die mithilfe eines Computers hergestellt sind. Um zum Anfang zurückzukehren, möchte ich noch hinzufügen: Um die Pest auszulöschen und zu besiegen, müssen wir die folgenden Fragen aufrichtig, das heißt schöpferisch, angehen:
• Erkennen, was die Pest ist (ohne das Recht, sich zu erschrecken!).
• Empfinden, ob wir genug innere Kraft haben, sie zu besiegen; wenn nicht:
• Es zu wagen. Gibt es eine Möglichkeit, ohne Notiz von der Pest zu nehmen, uns mit einem Zauberkreis zu umgeben, der uns vor dem bösen Auge schützt.
Die Antworten auf diese Fragen:
- ‹Pest› ist eine Bedingung der fortschreitenden Zersetzung unseres Sinnesgefüges, der Gefühle, der Gedanken und des Lebens selbst (als Spielregel getarnt hinter dem Zustand einer fieberhaften Vergnügungssucht).
- Eine ‹Pest› kann nur überwunden werden, wenn man das sich allmählich auflösende Gefüge des Lebens wiederherstellt. Das macht den spirituellen Kern aus, ohne den die Menschheit verdammt ist, entweder ausgelöscht zu werden oder, sogar etwas noch Schlimmeres, in eine Armee von Klonen zu mutieren.
- ‹Die Pest zu überleben› kann nur erreicht werden, wenn man seine Wurzeln und sein Haus hat. «Bestelle dein Haus!» – es ist kein Zufall, dass dies die Schlüsselworte zu J. S. Bachs Kantate 105 ‹Actus tragicus› sind.
Das führt uns zur Frage, die so alt wie die Welt ist: Ist es besser, hinzuschauen oder seine Augen zu verschließen? Zu wissen oder nicht zu wissen? Wesentlich zu sein oder nur so aufzutreten? Darauf gibt es keine einfache Antwort (wie auch, nebenbei erwähnt, für Alexander Puschkin in seinem ‹Gastmahl während der Pest›); die Aufgabe des Künstlers ist ‹nur›, das Problem in seinem ganzen Ausmaß zu erkennen und den eigenen Standpunkt dem Hörer darzustellen.
Der Künstler urteilt nicht; auch nicht unter den Bedingungen eines nicht endenden hysterischen Festes – die Verantwortung des Künstlers ist es, eine wirklichkeitsgemäße Sicht zu schaffen.
Wenn es diese gibt, dann besteht Hoffnung.»
Über Liebe und Hass
Eine ganz andere Welt öffnet sich in Gubaidulinas Oratorium ‹Über Liebe und Hass›, nach der ‹Johannes Passion› und ‹Johannes Ostern› ihr zweites Opus summum. Am 15. September 2018 leitete Valery Gergiev im Rotterdamer Konzertsaal De Doelen die Uraufführung des 15-sätzigen Werkes mit dem Philharmonischen Orchester Rotterdam sowie dem Chor und den Solistinnen und Solisten des Mariinski-Theaters. «Nach dem Verklingen des letzten Tons des 80-minütigen Werkes folgte zunächst eine lange Stille – dann brach jubelnder Beifall aus, und viele gingen nach vorn zur Bühne, um zu danken und zu fotografieren, während andere langsam in tiefer Kontemplation den Saal verließen.» (4) Doch die Komponistin suchte man vergebens, sie hatte wegen einer Rückenverletzung nicht nach Rotterdam reisen können.
Nach einer viermonatigen Textsuche hatte Gubaidulina aus Fragmenten von Bibel-Psalmen und Gebeten (Augustinus; Alkuin; Charles de Foucauld) bis zu einer Pfingst-Antifon in einer atmenden und gleichzeitig souverän geordneten Dramaturgie ein Textbuch zusammengestellt und merkte dazu an: «Für mich sind die Worte, der sakrale Text, das Hauptelement dieses Werkes, nicht die Musik, und ich liebe diese sakralen Worte.» Sie skizzierte die Struktur des Werkes in großen Zügen, bevor sie im Detail zu komponieren begann, und kalkulierte die Maße auf der Grundlage von symbolischen Zahlenreihen und dem Goldenen Schnitt. Aber letztlich waren es doch ihre Einbildungskraft und ihr Formsinn, welche den Kompositionsprozess vorangetrieben haben. «Ich fühle das Werk als ein Ganzes. Es ist kompliziert, eine Episode auf die andere folgen zu lassen. Und es ist immer eine wichtige Aufgabe, die essenziellen Punkte in der Form zu finden.» Dabei zeigte sich auf ihrem Gesicht das Lächeln eines jungen Mädchens. «Ein Hauptproblem war mir: Wohin kommt in der Gesamtstruktur als inhaltliches Zentrum der Satz ‹Bitterer Hass›?» Zunächst war es der Satz iv, wenn der Chor sein «Ich hasse» in fünf verschiedenen Sprachen herausschreit: deutsch, russisch, französisch, englisch, italienisch. Doch dieser zentrale Satz erschien Gubaidulina als zu früh positioniert. Darum fügte sie noch mehrere kurze Sätze ein, die darauf hinführen. Die jetzige Position als Satz ix brachte eine zeitlich entschiedenere Ordnung mit sich, und die Hass-Passage liegt nun im Goldenen Schnitt.
Dieses Opus summum, das in einer vielschichtigen musikalischen und textlichen Symbolik komponiert ist, beginnt mit ‹Als Jesus für mich starb› als Satz I. Nach einem eröffnenden Glockenton beginnt der Bass über einem tiefen aufgefächerten Orchesterklang. Er entfaltet Ton für Ton wie gegen Widerstände seine aufwärts strebende Melodielinie hin zu den zentralen Worten: «In der endlosen Morgenröte der Auferstehung» und wird von den zwei Chören mit beschwörenden Deklamationen begleitet, bis der Tenor von Feindseligkeit und Vergeltung zu singen beginnt.
Die folgenden Sätze II bis VIII führen vielschichtig auf Satz IX ‹Bitterer Hass› hin. Die Sätze X ‹Lass ab vom Zorn›, XI ‹Gebet um Erlösung› und XII ‹Aus dem Hohelied› vermitteln eine lösende und friedensstiftende Nuance, während der reine Orchestersatz XIII noch einmal ‹Gottes Zorn› zu Erlebnis bringt. Als XIV folgt ‹Einfaches Gebet› eines unbekannten irischen Benediktinermönches, das am Anfang vor allem Komponieren gestanden hatte, bis sich im Finale XV die pfingstliche Anrufung des Heiligen Geistes vollzieht. In verschiedenen Konstellationen und im Wechselgesang von Sopran, Bass und Chor werden zunächst gebetsartige Anrufungen an den Heiligen Geist in pfingstlichem Sinn intoniert. Ganz am Ende rezitiert der Bass mit Sprechstimme die zentrale Zeile der Pfingstantifon: «O komm, Heiliger Geist, entzünde in mir das Feuer deiner Liebe», während ein entrückter Klang von Zimbeln und Glockenspiel über gedämpftem Streicher- und Paukentremolo sich wie an das Göttliche annähert. Mit dem «in mir» − der Text war bisher «entzünde in uns das Feuer der Liebe» − wird abschließend der Bezug zur individuellen menschlichen Ebene hergestellt, die, so Gubaidulina, letztlich nur durch das gesprochene Wort vollzogen werden kann.
Die Komponistin ist sich bewusst, dass sie diese Welt von Hass nicht verändern, Kriege nicht ungeschehen machen kann. Doch hat sie in ihrer Religiosität aus tief empfundenem Schmerz, ja aus Liebe ein vielschichtiges Werk komponiert, das die Hörenden erschüttert und gleichzeitig andeuten kann: Der Weg des Menschen zum Göttlichen ist kein bequemer, sondern er führt durch Leiden und Schmerz, aber er kann Hilfe und Antwort des Göttlichen finden – im Sinn des Endes von Goethes ‹Faust›-Drama, wenn Engelchöre Fausts Sterbliches tragen und intonieren: «Wer immer strebend sich bemüht, / den können wir erlösen.»
Eine in Unordnung geratene Welt
Als ihr Verleger im Vorfeld des 90. Geburtstags Gubaidulina fragt, wie ihre Musik, insbesondere das Oratorium ‹Über Liebe und Hass›, in dieser in Unordnung geratenen Welt dazu beitragen kann, die Menschen zur Besinnung zu bringen und Frieden zu stiften, antwortet sie wie immer differenziert und nüchtern.
«Um auf die Frage zu antworten, muss man die tiefere Ursache des bedrohlichen Szenarios verstehen.
Im Wesentlichen ist das Problem mit den Begriffspaaren hoch/niedrig, ideell/materiell, gut/böse, endlich/unendlich zu erklären. Im Laufe der letzten 2500 Jahre verlor die Dimension des Erhabenen ihre vertikale Ausrichtung und bewegte sich in die Richtung einer Dimension der Flachheit. Gegenwärtig befinden sich diese zwei gegensätzlichen Dimensionen auf einer Linie, auf der Ebene einer ausschließlich materiellen, physischen Existenz. Zahlreiche Aspekte dieses Vorganges kollidieren miteinander und schaffen ein Chaos. Der Sog dieser existenziellen Entwicklung hat einen Punkt erreicht, an dem dieser in eine immer enger werdende Spirale überzugehen und auf eine Explosion zuzusteuern droht. Auch die Kunst der Musik ist, wie jede andere Kunstrichtung, von diesem existenziellen Gefühl tangiert. Warum? Weil gerade diese Kunstrichtung mit einer Materie zu tun hat, die das Endliche mit dem Unendlichen unmittelbar verbindet. In diesem Sinne verfügt gerade die Klangkunst über jenes Mittel, mit dessen Hilfe der Mensch in seinem rasanten Fall aufgehalten werden könnte.
Leider ist der Mensch, ungeachtet all seiner Vorzüge im Vergleich zu den anderen Lebewesen, unzulänglich und unreif. Und eher schrecklich schwach – und hoffnungslos zu spät. In diesem Sinne bin ich persönlich eher pessimistisch gestimmt.
Und dennoch habe ich eine gewisse Hoffnung: Ich setze auf die Begeisterung unserer gegenwärtigen Generation, das heißt der Musiker des 20. und 21. Jahrhunderts. Sind wir denn nicht glückliche Menschen? Wir haben die Möglichkeit, mit jenen Meisterwerken in Berührung zu kommen, die uns bereits vollendet vorliegen. All meine Hoffnung ruht daher auf den Interpreten dieses reichhaltigen Schatzes. All meine Hoffnung ruht auf den Vertretern und Veranstaltern, die sich für diese schöne und erhabene Kunst engagieren, und auf deren Begeisterung, die reell existiert und tatsächlich wirksam ist. Und die ist unzerstörbar!»
Aus ihrer klaren Charakterisierung der Zeitlage spricht gleichzeitig ein leuchtender Hoffnungsschimmer, ihre tiefe Liebe zu den musikalischen Meisterwerken und deren aufbauenden Kräften. Hier lebt ein essenzieller Keim für zukünftige Zeiten, denn die Musik ist wahrscheinlich die Kunst, die am tiefsten im Menschen zur Wirkung kommen kann.
Michael Kurtz
Erschienen in: Das Goetheanum – Wochenschrift für Anthroposophie Nr. 47, 19. November 2021
Michael Kurtz war von 2001 bis 2018 verantwortlicher Mitarbeiter Musik der Sektion für Redende und Musizierende Künste am Goetheanum. 2015 erschien ‹Rudolf Steiner und die Musik. Biographisches – Geisteswissenschaftliche Forschung – Zukunftsimpulse›. Er veröffentlichte weiter zur zeitgenössischen Musik in verschiedenen Sprachen. Gegenwärtig erweitert er sein Buch «Sofia Gubaidulina. Eine Biographie» für eine russische Ausgabe. Foto: Anna Krygier
Endnoten:
1- Rudolf Steiner, GA 275, 19. Dezember 1914, s. 45 f.
2- Richard Whitehouse-Feature Review- A Journay of the Soul: The Magic Music of Sofia Gubaidulina. Ohne Datum.
3- Renée Reitsma: A Celebration of Gubaidulina at the Concertgebouw, https://bachtrack.com/de_DE/review-gubaidulina-celebration-concertgebouw
4- ch danke meiner norwegischen Kollegin Bodil Maroni Jensen, dass ich frei aus ihrer Website über diese Aufführung zitieren darf.